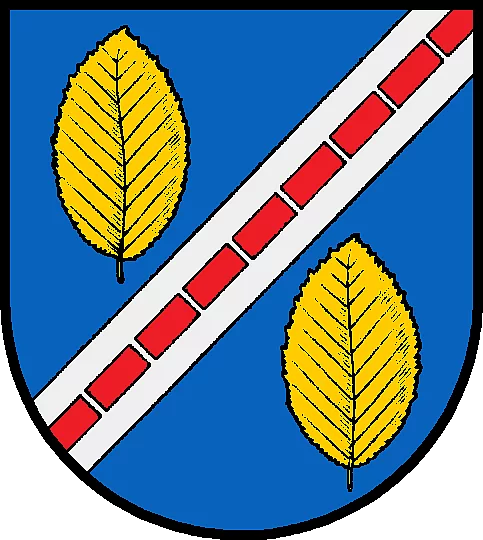Kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Boostedt
Klimaneutrale Wärme für die Gemeinde Boostedt
Die Gemeinde Boostedt hat im Jahr 2023 mit der kommunalen Wärmeplanung begonnen. Zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde eine Lenkungsgruppe mit sechs Personen gegründet. Das Ingenieurbüro PlanNeo aus Kiel hat die kommunale Wärmeplanung für Boostedt erstellt. Der Bewilligungszeitraum für die bewilligte Förderung endete am 30.11.2025. PlanNeo hat Analysen und Bewertungen über die Gemeinde erstellt. Zudem wurde eine Strategie für die Wärmeplanung sowie ein Beteiligungs- und Netzwerkmanagement entwickelt. Der Abschlussbericht zur kommunalen Wärmeplanung wurde von der Gemeindevertretung am 17.11.2025 beschlossen.
In den Fragen und Antworten (FAQ’s) haben wir Informationen zu den häufigsten Fragen rund um die zukünftigen Regelungen und Änderungen für Sie zusammengefasst.

FAQs:
-
1. Warum ist kommunale Wärmeplanung wichtig?
-
2. Welche Schritte beinhaltet die kommunale<s class="msoDel">n</s> Wärmeplanung?
-
3. Welche Faktoren beeinflussen Entscheidungen in der kommunalen Wärmeplanung?
-
4. Wie kann die Wärmeplanung zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen?
-
5. Inwiefern betrifft die Einwohner*innen die kommunale Wärmeplanung?
-
6. Wie können Einwohner*innen sich an der kommunalen Wärmeplanung beteiligen?
-
7. Besteht durch die kommunale Wärmeplanung der Gemeinde Boostedt eine Austauschpflicht für meine Gas- oder Ölheizung
-
8. Meine Heizung ist kaputt oder muss bald getauscht werden. Was soll ich tun?
-
9. Ist es sinnvoll mein Gebäude zu sanieren?
-
10.Wie geht es nach der kommunalen Wärmeplanung weiter?
3. Weitere mögliche Fragen mit Antworten:
-
11. Darf ich trotz Vorliegen einer kommunalen Wärmeplanung noch eine fossil betriebene Heizung einbauen?
-
12. Was sollte ich beim Heizungstausch beachten?